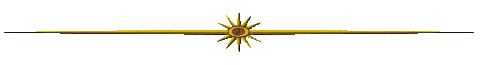Entzifferung der Hieroglyphen
Zu allen Zeiten übten die Hieroglyphen auf die Menschen
eine unerklärliche Faszination aus. Es wurden immer wieder Versuche das
Geheimnis diese Zeichen zu entziffern und verstehen unternommen.
Der deutsche Pater Athanasius Kirchner lieferte im 17.
Jahrhundert den ersten richtigen Ansatz zur Entzifferung der Hieroglyphen,
indem er erkannte, daß das Koptische dem letzten Sprachstand der alten
ägyptischen Sprache darstellt und keine unabhängige Sprache war. Die
Bedeutung der Hieroglyphen vermochte er allerdings auch nicht zu enträtseln.
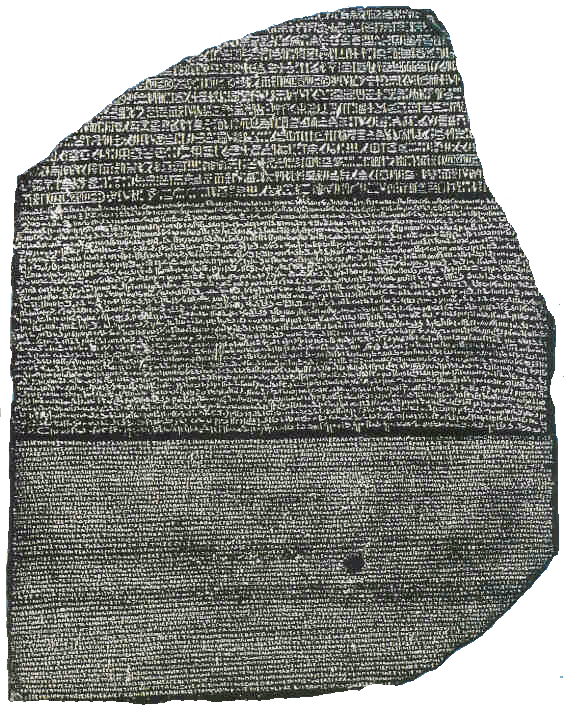
Den Schlüssel zur Entzifferung der ägyptischen Hieroglyphenschrift lieferte der Fund eines
Steinfragment aus schwarzem Basalt, das 118 cm hoch, 77 cm breit, 30 cm tief ist und 762 kg wiegt. Dieses Steinfragment fanden 1799 bei Schanzarbeiten französische Soldaten unter der Leitung des Offiziers P. Bouchard im Nildelta Nähe Alexandria in einer Mauer am Fort Julien bei Rosetta (Raschid).
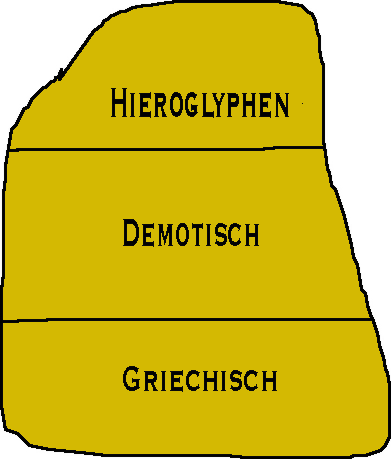
Auf dem Stein waren Inschriften in zwei Sprachen und mit drei Schriften eingemeißelt und zwar griechisch, demotisch (jüngste Form der ägyptischen Schrift und Sprache, ab der Spätzeit und während der gesamten Römerzeit gebräuchlich) und in altägyptischer Sprache (Hieroglyphen). Bouchard erkannte wohl, daß dies ein wichtiger Fund war und meldete seinen Fund. So gelang dieser Stein nach Kairo in das Institut „National“. Napoleon ließ davon Abschriften in Tinte machen und schickte diese an die Gelehrten Europas.
DER GRIECHISCHE TEXT AUF DEM STEIN
(deutsche Übersetzung )
 klick hier...
klick hier...
“ Das Dekret soll auf eine Stele aus Hartgestein mit den heiligen, den volkstümlichen und den griechischen Schriftzeichen geschrieben werden."
Nach
dieser Aussage wußte man, daß alle drei Textteile den gleichen Inhalt haben.
Ein Problem war allerdings immer
noch, nachdem man das altgriechische übersetzt hatte, die Hieroglyphen zu
dechiffrieren.
Zwei Männer schafften es dann schließlich den sogenannten Code der Hieroglyphen zu entschlüsseln.
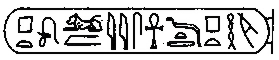
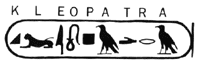
Dr. Robert Young, ein Engländer.
Er erkannte, daß den Hieroglyphen ein
phonetisches System zu Grunde lag. Auch stellte er fest, im Vergleich zu dem
griechischen Teil, daß ovale Kartuschen Königsnamen enthielten. Da Ptolemäus
ein griechischer Name war, suchte er die Laute P-T-L-M und verglich diese
mit den Anordnungen in anderen Kartuschen und konnte diese Anordnung auch im
Namen Kleopatra in der Richtigen Reihenfolge erkennen.
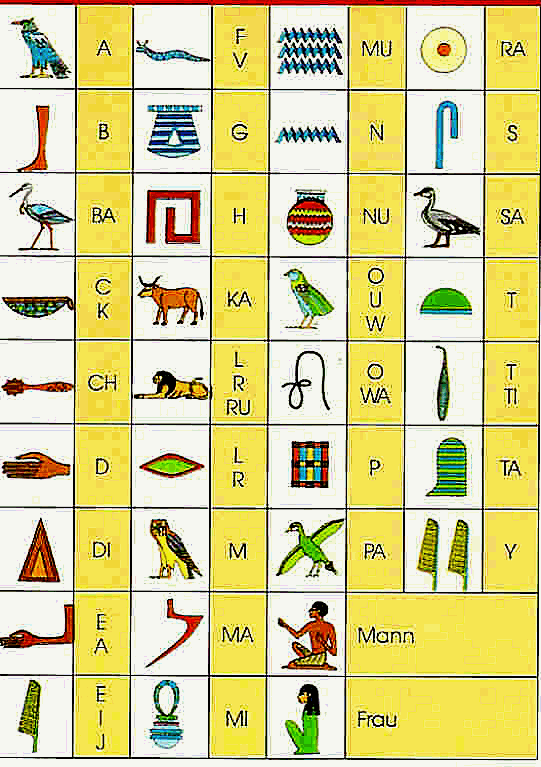
Nun konnte er zwar die Namen lesen, aber noch nicht den Text. 1818 veröffentlichte er in der Encyclopaedia Britannica ein Lexikon des Altägyptischen, bestehend aus 204 Schriftzeichen (davon 50 korrekt) und 14 Hieroglyphenzeichen mit phonetischer Lesung, von denen die Hälfte richtig war. Doch weiter kam er nicht, und so gab er später auf.
Als das Christentum nach Ägypten kam, übersetzten die ägyptischen Christen die biblischen Texte in ihre Muttersprache, dem koptischen. Diese christianisierten Ägypter wurden als Kopten bezeichnet. Noch bis zum heutigen Tag benutzen diese ihre alte Sprache in religiösen Texten.

Diesen Umstand machte sich Jean-Françios Champollion zu Nutze, als er die Entdeckungen Youngs weiter verfolgte. Schon als junger Mann studierte er die koptische Sprache und war damals auf diesem Gebiet eine Autorität. Seine Kenntnisse der koptischen Sprache befähigten ihn, die phonetischen Worte vieler Silbenzeichen abzuleiten und genaue Lesenarten vieler Bilder zu bestimmen, deren Bedeutung ihm aus dem griechischen Text von dem Stein bekannt war.
Dies war der Anfang, der Grundstein zur Entzifferung der Hieroglyphen. Allerdings sollten noch Jahrzehnte vergehen, ehe man die hieroglyphischen Schriften von Anfang bis Ende lesen konnte.
Chabas, Brugsch und Goodwin benutzten
die von Champollion gelegten Grundlagen und erforschten weiter Stück für
Stück diese Sprache mit ihrer grammatischen Struktur.
Diese Ergebnisse wurden von Adolf
Ermann, dem Begründer der ägyptischen Philologie, zusammengefaßt.
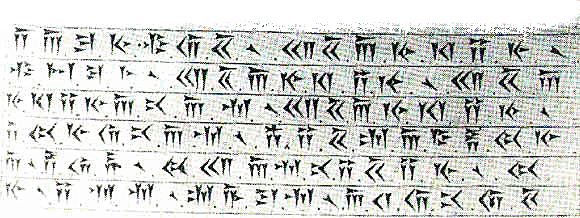
Fast zur gleichen Zeit, wie die Entzifferung der Hieroglyphen gab es eine ebenso bedeutende sensationelle Entdeckung, die Dechiffrierung der Keilschrift.
Diese Keilschrift wurde zuerst von den Babyloniern, später von den Persern und den Hethitern benutzt, welche eine wichtige Rolle in der ägyptischen Geschichte spielten. Im Gegensatz zu den Ägyptern, schrieben diese statt auf Papyrus und in Stein, ihre keilförmige Schriftzeichen auf Tontafeln.
Interessante Funde machte man in Tell-el-Armana, welche am Ende der 28. Dynastie ägyptische Hauptstadt unter Echnaton war. Hunderte von Briefen, die Echnatons Gouverneure der assyrischen, phönizischen und babylonischen Kronkolonien geschrieben hatte, wurden hier gefunden.
Diese Entdeckung gab den Ägyptologen Einsicht über den Umfang des ägyptischen Reiches auf der Höhe seiner Macht.